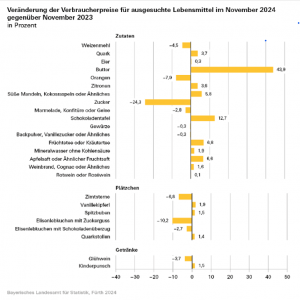Vom 24. bis 26. Oktober 2024 lud der Bayerische Müllerbund zur alljährlichen Müllerei-Fachtagung für Getreide, Qualitätsbeurteilung, Technologie und Wirtschaft nach Volkach am Main ein – mit großem Erfolg! Neben den informativen Vorträgen war ein Highlight der legendäre Fränkische Abend, der dieses Jahr in die Bürgerspital Weinstuben nach Würzburg führte. Die Herbstfachtagung verzeichnete in diesem Jahr bereits zum wiederholten Male einen Besucherrekord.
Die Tagung in diesem Jahr war die bisher am meisten besuchte Müllerbunds-Veranstaltung in Volkach. Bereits am ersten Tagungstag war der Vortragssaal gut gefüllt, was der absolute Besucherrekord von insgesamt etwa 300 Teilnehmern unterstreicht.
Das Aussteller-Forum war ebenfalls bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht, und die breite Palette der Aussteller bot eine Fülle wichtiger und kompetenter Zulieferfirmen für die Mühlenwirtschaft. Dieses Jahr gab es sogar zwei zusätzliche Zelte, um die Ausstellungsfläche zu erweitern, denn die Müllereifachtagung in Volkach bietet nicht nur eine Vielzahl interessanter und hochaktueller Vorträge für die Branche, sondern auch die Möglichkeit zum Austausch mit renommierten Fachausstellern.

Auch Teilnehmer aus dem angrenzenden Ausland konnten wieder begrüßt werden. So kamen Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz und Polen zur Fachtagung nach Volkach. Der Weg nach Volkach ist niemandem zu weit.
Der Präsident des Bayerischen Müllerbundes, Rudolf Sagberger, eröffnete die 49. Müllereiherbstfachtagung und hieß die Teilnehmer herzlich willkommen und machte auf die Herausforderungen der Mühlenwirtschaft aufmerksam (Siehe Pressemitteilung zur Müllereifachtagung).
Der Donnerstagnachmittag stand im Zeichen der Getreidemärkte und Wertschöpfungsketten. Martin Unterschütz von der BayWa AG gab eine detaillierte Analyse zur Erntebilanz 2024 und zur Versorgungslage mit Qualitätsgetreide. Kurt Fromme beleuchtete die Auswirkungen zunehmender gesetzlicher Anforderungen auf die Warenströme, während Ulrike Bitzer und Helge Evers innovative Ansätze zur Digitalisierung der Getreideannahme vorstellten. Ein besonderes Highlight des Tages war der Vortrag von Jörg Große-Lochtmann, der Einblicke in die Entwicklungen des Biomarktes gab und Herausforderungen und Chancen für die Zukunft der Branche aufzeigte.
Der Freitag widmete sich den Themen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit. Peter Hirschmann vom Müllerbund gab praxisnahe Hinweise zur Reduzierung des Stromverbrauchs in Mühlenbetrieben und veranschaulichte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der CO₂-Reduktion: Stefan Prockl von Bühler AG und Andreas Hummel präsentierten Methoden zur Ermittlung und Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks in der Müllerei. Abgerundet wurde der Tag durch Vorträge zur Getreidequalität und zum Qualitätsmanagement – besonders relevant für alle, war der Vortrag von Norman Krug zur Muttern- und Ergotalkaloidreduzierung in Mühlen.
Vor der Mittagspause wurde den Teilnehmern am diesjährigen DON-Vorerntemonitoring ihr Teilnahmezertifikat überreicht. Allen teilnehmenden Mühlen nochmals ein herzliches Dankeschön. Nach der Mittagspause stellten sich wie jedes Jahr die Fachfirmen vor.
 Am Freitagabend fand der traditionelle Fränkische Abend statt. In diesem Jahr ging es für die Tagungsteilnehmer nach Würzburg in die Bürgerspital Weinstuben. Bei gutem Essen, ausgewählten fränkischen Weinen und stimmungsvoller Musik feierten die Gäste den Abend.
Am Freitagabend fand der traditionelle Fränkische Abend statt. In diesem Jahr ging es für die Tagungsteilnehmer nach Würzburg in die Bürgerspital Weinstuben. Bei gutem Essen, ausgewählten fränkischen Weinen und stimmungsvoller Musik feierten die Gäste den Abend.
Am Samstag, dem letzten Tag der Fachtagung, lag der Fokus auf Müllereitechnik. Stefan Schmitz von der Swisca AG stellte innovative Technologien in der Getreidevermahlung vor, und Paul und Felix Bruckmann von der MIAG GmbH boten spannende Einblicke in die Planung und den Bau moderner Mühlen. Verschiedene Bau- und Umbaukonzepte wurden vorgestellt, darunter alternative Gebäudestrukturen und die Neugestaltung bestehender Anlagen, die auf reges Interesse stießen.
Der Präsident des Bayerischen Müllerbundes, Rudolf Sagberger, dankte in seinem Schlusswort allen Müllerinnen und Müllern für ihr Kommen und das mitgebrachte Interesse. Abschließend bat er die Teilnehmer auch in Zukunft diese informative Plattform für die Branche zu nutzen, um sich untereinander auszutauschen, miteinander zu diskutieren und den eigenen Horizont zu erweitern.